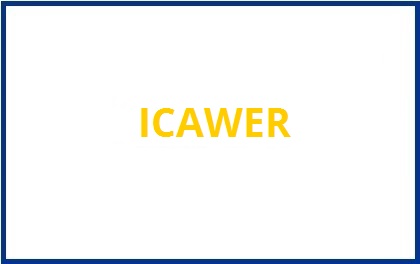Achse 1 - Forschung und Innovation
Wichtigste Herausforderungen
1a) Ausbau der Infrastruktur im Bereich Forschung und Innovation (F&I)
Mit seinen zahlreichen Hochschulen und Universitäten, Wissenschafts- und Technologieparks sowie Forschungszentren verfügt das Kooperationsgebiet über weitreichende Kapazitäten in Forschung und Innovation. Auf grenzüberschreitender Ebene arbeiten Technologieparks, Forschungszentren und Universitäten zwar teilweise heute schon erfolgreich zusammen, jedoch ist esvon entscheidender Bedeutung, die verfügbaren Kapazitäten auch längerfristig sinnvoll zu nutzen.
Vor diesem Hintergrund werden insbesondere folgende grenzüberschreitende Entwicklungen angestrebt:
- Stärkung des grenzüberschreitenden Erwerbs wissenschaftlicher und technischer Kompetenzen;
- Verbesserung des Wissensaustausches und der Synergien durch Zusammenführen von Wissenschaftsnetzwerken.
1b) Förderung von Investitionen der Unternehmen in F&I
Bei den innovativen Unternehmen, die im Kooperationsgebiet angesiedelt sind,verhält es sich ähnlich: Die Region verfügt über eine Vielzahl hoch innovativer Unternehmen, vor allem KMU und Forschungseinrichtungen, die Vernetzung zwischen diesen ist jedoch vor allem auf grenzüberschreitender Ebene nur schwach ausgeprägt. Um das Innovationspotenzial im Grenzraum nutzen und ausbauen zu können, ist es daher von großer Bedeutung den Austausch zwischen KMU und Forschungseinrichtungen zu stärken und den Aufbau von Netzwerken zwischen diesen Akteuren zu fördern.
Vor diesem Hintergrund werden insbesondere folgende grenzüberschreitende Entwicklungen angestrebt:
- Steigerung von grenzübergreifenden Kompetenzentwicklungen sowie Schaffung von Transferschnittstellen zur Unterstützung von Unternehmen
- Stärkung der grenzüberschreitend aktiven oder integrierten Cluster
- Spezifische Unterstützungen von Unternehmen, vor allem KMU und Startups, um F&I-Aktivitäten effizienter umzusetzen.
Im Rahmen der Achse 1 wurden in zwei Aufrufen 34 Projekte mit einem Gesamtbudget von 31.128.097,50 Euro genehmigt.
Hier finden Sie die vollständige Liste aller vom Programm finanzierten Projekte.
 REBECKA
REBECKA

REBECKA
Rebsorten- und Weinbauflächen-Bewertungsmodell unter Berücksichtigung der Auswirkungen und Chancen des Klimawandels in den Alpen
Die alpine Landwirtschaft, gerade auch mehrjährige Kulturen wie der Weinbau, stehen in einer globalisierten Welt aufgrund der ungünstigen topographischen und sozio-ökonomischen Voraussetzungen sowie der Auswirkungen des Klimawandels unter großem Druck. Ziel des Projektes ist es, ein flächendeckendes und objektives Bewertungsmodell für die Weinbaueignung der Grundparzellen in Südtirol und in Kärnten zu erstellen. Um eine nachhaltige Planung im Weinbau zu ermöglichen, wird dabei die beobachtete Klimaänderung der vergangenen 20 Jahre und deren Auswirkungen auf den Weinbau mitberücksichtigt. Die geplanten Arbeiten können in 3 Schwerpunkte zusammengefasst werden: erstens die Auswertung historischer Erntedaten verschiedener Südtiroler und Kärntner Kellereibetriebe, um den Entwicklungsverlauf über die Jahre zu beschreiben und eine Relation zu den sich verändernden klimatischen Rahmenbedingungen herzustellen. Zweitens werden insgesamt 40 über das gesamte Weinbaugebiet verteilte Rebstandorte erfasst, deren Klimaparameter erhoben und die Entwicklungsparameter der Rebe beschrieben. Drittens wird ein Bewertungsmodell entwickelt, in welches sowohl die Auswertung der historischen Erntedaten wie auch die weinbaulichen und klimatischen Erhebungen einfließen. Das Bewertungsmodell wird allg. zugänglich gemacht und laufend aktualisiert.Für dieses Projekt hat sich ein interdisziplinäres Team mit sich ergänzenden Stärke- und Kompetenzfeldern aus Südtirol und Kärnten zusammengeschlossen.
Projektpartner
- Lead Partner (BZ) Versuchszentrum Laimburg
- Projektpartner 1 (BZ) EURAC Bozen
- Projektpartner 2 (KAR) JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
- Projektpartner 3 (KAR) Kammer für Land- und Forstwirtschfat in Kärnten
Projektbudget
751.234,65 Euro
Projektdauer
01.11.2016 - 30.04.2019
Projektwebsite
Publikationen und Pressespiegel
 Concrete
Concrete

Concrete
Oberflächenvergütung von Betonbauwerken – Erhöhung der Dauerhaftigkeit durch neuartige Schutzmaßnahmen
Die Schwierigkeiten bei Bauausführungen machen vor nationalen Grenzen keinen Halt und betreffen das gesamte Gebiet Nord- und Südtirols in selbiger Weise. Strategische Betonbauwerke sind den regionalen Einflüssen gleichermaßen ausgesetzt, die maßgeblich durch die klimatisch vorherrschenden Rahmenbedingungen und die territorial vorhandenen Rohstoffressourcen des Alpenraums charakterisiert werden. Diese regionalen Besonderheiten finden in den europ./nat. Gesetzen und Normen jedoch unzureichende Beachtung. Die Konsequenzen aus dieser fehlenden (Inter-)Regionalisierung führen je nach Bauwerk und Belastung zu teils stärker auftretenden Arten von Schädigungen, die maßgeblichen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit der Bauwerke haben und zu unterschiedlichen Herangehensweisen, Lösungsansätze und Erfahrungswerte für gleiche Problemstellungen. Im Rahmen des vorliegenden Projekts soll das interregionale Know How gebündelt und zu einem gemeinsamen Wissenspool zusammengeführt, die lokalen Rohstoffe und Rahmenbedingungen analysiert und an neuartige Oberflächenvergütungen bzw. der Natur nachgeahmte, innovative Schutzmaßnahmen angepasst werden, um die Instandsetzungsintervalle bzw. den gesamten Lebenszyklus eines Betonbauwerkes im Rahmen des optimierten Bauwerks- und Erhaltungsmanagementsystems laut europäischen Standards zu verlängern. Diese Untersuchungen werden von einem Monitoring an Bauwerken begleitet, um die Praxistauglichkeit und Plausibilität der Laboruntersuchungen zu garantieren.
Projektpartner
- Lead Partner (TIR) Wasser Tirol - Wasserdienstleistungs-GmbH
- Projektpartner 1 (BZ) ISB Istituto tecnologia materiali edili Alto Adige scrl
- Projektpartner 2 (BZ) KOFLER & RECH SPA
- Projektpartner 3 (BZ) Beton Eisack srl
Projektbudget
1.388.994,76 Euro
Projektdauer
14.03.2016 - 30.04.2019
 RE-CEREAL
RE-CEREAL

RE-CEREAL
Netzwerk zur Erforschung und Technologietransfer für den verbesserten Einsatz von wirtschaftlich untergeordnetem Getreide und Pseudocerealien
Ziel des Projekts ist der Ausbau der grenzübergreifenden Zusammenarbeit von Universitäten, Versuchszentren und Unternehmen, über die Bildung eines Netzwerks von Partnern mit multidisziplinären Kompetenzen (Genetik, Agronomie, Chemie, Ernährungslehre und Lebensmittel-herstellung). UG und PC wie Buchweizen, Hirse und Hafer, die bis Mitte des 20. Jh. im Programmgebiet angebaut wurden, werden heute gegenüber ertragreicheren Kulturen wie Weizen und Mais vernachlässigt. Die negativen Folgen sind u. a. die Ausbeutung der bestellten Böden mit Monokulturen und der Verlust von Nährstoffen, die im Zuge der maximierten technologischen Verwertbarkeit des Getreides in den Hintergrund treten. Dagegen besitzen UG und PC viele Qualitäten: Ihr Anbau fördert Biodiversität und Nachhaltigkeit der Nahrungskette (aufgrund ihrer geringeren Ressourcenintensivität) und der hohe Gehalt an Aminosäuren, Mineralien und Vitaminen bereichert unsere Ernährung. Darauf beruht ihre Bedeutung für glutenfreie sowie traditionelle Lebensmittel, in denen auch Weizen verarbeitet wird. Vor diesem Hintergrund bezweckt das Projekt, ein Netzwerk zu schaffen, in dem Fachkompetenz gemeinsam genutzt und Wissen weitergegeben wird, um den Anbau von UG und PC zu fördern und durch Verbesserung der Züchtungstätigkeit und genetische Selektion, die vermehrte Verwendung in der Lebensmittelindustrie und die Potenzierung der ernährungsphysiologischen Bestandteile in Lebensmitteln wie Brot, Nudeln und Gebäck zu erhöhen.
Projektpartner
- Lead Partner (BZ) Dr. Schaer SpA
- Projektpartner 1 (BZ) Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg
- Projektpartner 2 (FVG) Università degli studi di Udine
- Projektpartner 3 (TIR) Universität Innsbruck
- Projektpartner 4 (KAR) Dr.Schär Austria GmbH
- Projektpartner 5 (KAR) KÄRNTNER SAATBAU
Projektbudget
1.322.623,53 Euro
Projektdauer
14.03.2016 - 30.04.2019
Projektwebsite
Publikationen und Pressespiegel
 IDEE
IDEE

IDEE
Grenzübergreifendes Forschungsnetzwerk für das Integrative Design Effizienter Energiesysteme in urbanen Regionen
Die EU 2020 Strategie und der EU Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft sehen einen direkten Zusammenhang zwischen Ressourceneffizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit von Regionen. Es ist davon auszugehen, dass hohe Effizienz im zukünftigen Gebäudebestand, neue Technologien wie Niedertemperaturfernwärme und Wärmepumpen, Abwärmenutzung und die Reduktion von Energieverlusten in der Industrie sowie die Erschließung des Biomassepotenzials die Energiesysteme sauberer und effizienter machen. Das Projekt IDEE wird auf Ergebnisse aus dem Projekt Urban Energy Web aufbauen und ein grenzüberschreitendes Forschungsnetzwerk zur „Integrativen Systemanalyse und Design von effizienten und innovativen urbanen Energiesystemen“ schaffen. In diesem Netzwerk ergänzen sich Kompetenzen von 4 Forschungszentren und einer öffentlichen Behörde, um ein integratives Modellierungsframework für urbane Energiesysteme zu entwickeln. Dieses Framework interpretiert Energie-, Umwelt-, Gebäude-, Wirtschafts- und geographische Daten in integrativer Weise und schafft so neue Entscheidungsgrundlagen. Es unterstützt Kommunen und Schlüsselakteure durch strategischen Input zu vorhandenen Potenzialen, Anwendbarkeit von innovativen Technologien und deren Umwelteinfluss, Kosten und Rentabilität, Energieinvestitionen im urbanen Raum zu planen. Dieses Modellierungsframework wird in Pilotregionen (Maniago, Feltre und Salzburger Seenland) entwickelt, validiert und für eine breite Anwendung darüber hinaus angelegt.
Projektpartner
- Lead Partner (FVG) Università degli studi di Udine
- Projektpartner 1 (VEN) Certottica Scrl
- Projektpartner 2 (SBG) Research Studios Austria Forschungsgesellschaft mbH
- Projektpartner 3 (VEN) Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano del piave appartenenti alla Provincia di Belluno
- Projektpartner 4 (IT) Università Iuav di Venezia
Projektbudget
873.273,15 Euro
Projektdauer
02.11.2016 - 03.05.2019
Projektwebsite
Publikationen und Pressespiegel
.
 Labs.4.sme
Labs.4.sme

Labs.4.sme
Digital Labs 4.0 für die Innovation der grenzüberschreitenden KMU
Labs wurden vom Mit wie folgt definiert: "Orte, an denen man seinen Ideen Ausdruck verleihen, kreativ sein, lernen, beraten und erfinden kann." Diese Aspekte bieten breites Innovationpotential für KMU und angewandte Forschung. Es sind Einrichtungen, die eine Reihe von Dienstleistungen anbieten und zur Verfügung haben, mit denen sie Unternehmen reibungslos und rasch bei Ko-Projektierungsverfahren für international wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen unterstützen können. KMU sind leider nach wie vor oft aufgrund ihrer geringen Größe benachteiligt und können daher die Kosten für Investitionen in R&I nicht stemmen. Digital Labs 4.0 für die Innovation von KMU in einem grenzübergreifenden Gebiet (Labs.4.SMEs) hat es sich zum Ziel gesetzt, die Innovationslücke der KMU im grenzübergreifenden Einzugsgebiet mit Hilfe eines Modells und geeigneter Kooperationsinstrumente zu füllen. Besagte Mittel sollen die innovative Rolle der Labs für KMU aufwerten, und den KMU bei der R&I-Tätigkeit „benutzerfreundlich“, also zeit- und kostengünstig, zur Seite stehen. Unternehmer und Fabbers genießen folgende Vorteile: - Eine Karte der Labs im grenzübergreifenden Einzugsgebiet, - eine Webplattform mit den Aufgaben: Sichtbarkeit für Dienstleistungen der Labs, Abstimmung von Nachfrage (KMU) und Angebot (Labs), Schaffung eines Netzwerks zur Begünstigung von Synergien zwischen KMU und Labs, - wirksames und auf andere Situationen übertragbares Kooperationsmodell für Labs und Unternehmen.
Projektpartner
- Lead Partner (IT) ECIPA
- Projektpartner 1 (VEN) FABLAB Castelfranco Veneto SRL
- Projektpartner 2 (FVG) Associazione artigiani piccole medie imprese Trieste confartigianato
- Projektpartner 3 (BZ) APA-formazione e servizi cooperativa
- Projektpartner 4 (TIR) FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH
- Projektpartner 5 (SBG) Salzburg Research Forschungsgesellschaft
Projektbudget
1.101.836,00 Euro
Projektdauer
03.02.2017 - 01.11.2019
Projektwebsite
Publikationen und Pressespiegel
 PreCanMed
PreCanMed

PreCanMed
Erstellen einer "Precision Cancer Medicine“ Plattform
Therapien die auf der Basis von genetischen Patientenprofilen ausgewählt werden repräsentieren eine neue Strategie in der Behandlung von Krebserkrankungen. Es wird erwartet, dass diese Strategien die sozio-ökonomische Belastung von teuren und oft schlecht wirksamen traditionellen Therapien reduzieren und so die regionalen Gesundheitssysteme entlasten. In diesem Zusammenhang haben Tumor-Organoide eine große Bedeutung. Tumor-Organoide sind dreidimensionale Zellkomplexe die im Reagenzglas aus Zellen kultiviert werden die zuvor aus Tumorproben oder –biopsien gewonnen worden. Die ursprünglichen Eigenschaften des Patienten-tumors werden durch Tumor-Organoide genau widergespiegelt. Deswegen stellen Tumor-Organoide ein ideales Werkzeug dar um patienten-spezifische Therapiestrategien in Wirkstoffscreenings zu "er-testen". Das Ziel des PreCanMed Projekts ist die Kollaboration zwischen italienischen und österreichischen Instituten, die im Bereich der genetischen, klinischen und biotechnologischen Forschung tätig sind, zu stärken um eine gemeinsame Kompetenz-Plattform für die Gewinnung, Kultivierung, Konservierung von Tumor-Organoide aus einer Vielzahl von Patienten (Live-Organoid-Biobank) und deren Nutzung in Wirkstoff-screenings zu errichten. Tumor-Organoide und know-how wird frei zur Verfügung gestellt und macht dadurch diese Technologie leicht zugänglich für akademische, klinische und pharmazeutische Forschung und Entwicklung.
Projektpartner
- Lead Partner (FVG) Consorzio interuniversitario per le biotecnologie - Laboratorio nazionale
- Projektpartner 1 (FVG) Università degli studi di Udine
- Projektpartner 2 (FVG) Università degli Studi di Trieste
- Projektpartner 3 (TIR) Università di medicina Innsbruck
- Projektpartner 4 (TIR) ADSI - Austrian Drug Screeening Institute GmbH
Projektbudget
1.294.139,55 Euro
Projektdauer
14.03.2016 - 30.06.2019
Projektwebsite
Publikationen und Pressespiegel
 ICAP
ICAP

ICAP
Innovation durch kombinierte Anwendungen von Plasmatechnologien
Heutzutage sind die Produktinnovation und der effiziente Gebrauch von Ressourcen (Energie, Rohstoffe etc.) Erfolgsfaktoren für Unternehmen. Die Oberflächenbehandlungen, in diesem Zusammenhang, sind strategisch wichtig, da sie ermöglichen, Substrate zu dekorieren, zu schützen und ihnen die gewünschten physikalischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften zu verleihen. Viele der von einem Material geforderten Merkmale sind von dessen Oberflächeneigenschaften abhängig: Imstande zu sein, dessen Eigenschaften zu modifizieren, Ressourcen zu sparen, Abfall und Emissionen zu reduzieren, ist ein wichtiges Instrument für Unternehmen im Programmgebiet. Plasmatechnologien ermöglichen es, die Oberflächeneigenschaften mit Hi-Tech- und umweltfreundlichen Prozessen zu modifizieren. Es existieren Hindernisse für die Nutzung dieser Technologien durch eine Nichtverfügbarkeit der Anlagen, durch das erforderliche Know-how für deren Betrieb und insbesondere die Kosten für die Versuchsdurchführungen und Prüfungen. Dank dem Projekt wird es möglich sein, die Ausrüstungen und die multidisziplinären Kompetenzen der Partner zusammenzuführen, um diese Barrieren zu überwinden. Die Hauptaktivitäten in diesem Projekt sind: - Identifizierung des Bedarfs der KMUs im Programmgebiet - Versuchsdurchführungen - Kombination der unterschiedlichen Plasmatechnologien - Verbreitung, Information und Vermarktung der Studien und der Ergebnisse
Projektpartner
- Lead Partner (VEN) Certottica Scrl
- Projektpartner 1 (KAR) Kompetenzzentrum Holz GmbH
- Projektpartner 2 (TIR) Universität Innsbruck
- Projektpartner 3 (FVG) CONSORZIO INNOVA FVG
Projektbudget
837.905,11 Euro
Projektdauer
01.07.2016 - 31.12.2018
Projektwebsite
 AppleCare
AppleCare

Apple Care
Therapie der Birkenpollenallergie durch Apfelkonsum
Pollenallergien kommen bei bis zu 20% der mitteleuropäischen Bevölkerung vor und verzeichnen in den letzten Jahren auch in Tirol und Südtirol eine deutliche Zunahme. Für eine wirksame Therapie muss eine langfristige Hyposensibilisierung gegen das Allergen des Birkenpollens Bet v1 durchgeführt werden, bei welcher der Allergiker über mehrere Jahre hinweg das Allergen in Form synthetischer Präparate zu sich nimmt, um sein Immunsystem an die Allergene zu gewöhnen. Eine Hyposensibilisierung über die gewöhnliche Aufnahme von Nahrungsmitteln wäre im Vergleich dazu von allergrößtem Vorteil. Das Birkenallergen Bet v1 weist eine starke Homologie mit der Apfelallergen-Familie Mal d1 auf, was im menschlichen Immunsystem eine Kreuzreaktion zur Folge hat. Dies bietet die Chance, mit einer kontrollierten Aufnahme der richtigen Apfelmenge die Pollenallergie zu behandeln. Durch die grenzüberschreitende Nutzung der Forschungskapazitäten in den Bereichen Medizin, Molekularbiologie und Strukturchemie werden jene Apfelsorten und jene Dosierungen ermittelt, die sich am besten für eine Heilung von Pollenallergikern eignen. Aus dieser interdisziplinären Synergie heraus ergibt sich, neben der Erstellung einer interregionalen Datenbanken von Allergiepatienten, eine Auswahl jener Obstsorten, die sich sowohl für eine allergenarme Diät als auch für den Einsatz als nachhaltiges Therapiemittel, und somit für den Ausbau des Innovationspotentials beidseitig des Brenners, bestens eignen.
Projektpartner
- Lead Partner (BZ) Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg
- Projektpartner 1 (TIR) Universität Innsbruck
- Projektpartner 2 (TIR) Università di medicina Innsbruck
- Projektpartner 3 (BZ) Azienda Sanitaria dell'Alto Adige - Comprensorio sanitario di Bolzano
Projektbudget
799.905,32 Euro
Projektdauer
01.01.2017 - 30.06.2019
Projektwebsite
Publikationen und Pressespiegel
.
 MEMS
MEMS

MEMS
Heterogenität von Melanomen: von den Bergen zum Meer – Meereshöhe, Sonnenexposition und Umweltverschmutzung in der Entwicklung von kutanen Neoplasien
Das Melanom ist ein Tumor der Haut, der bei höherer Exposition von UV-Strahlen bei hellhäutigen Personen in Industrieländern zunehmend auftritt. Ziel des Projektes MEMS ist es, die Zusammenarbeit der Forschungseinrichtungen im Partnerschaftsgebiet des Programmes zu stärken, um besseren technischen und wissenschaftlichen Austausch im Bereich der Melanomforschung zu ermöglichen. Durch die Vereinigung von Wissenschafts- und Gesundheitseinrichtungen in Österreich und Italien macht sich das Projekt zum Ziel, zu erforschen, ob Umwelteinflüsse wie Seehöhe des Wohnortes, die UV-Einstrahlung und/oder eine mögliche Umweltbelastung Auswirkungen auf den Typus des Melanoms der Haut und seine Progression haben. Das Projekt ist innovativ, indem es die unterschiedliche geographische Beschaffenheit der Orte den verschiedenartigen klinischen, mikroskopischen und molekularen Ausprägungen des Melanoms gegenüberstellt. Die zu untersuchende Region ist äußerst heterogen – das Meer (Triest), die Nord- und Südseite der Alpen (Tirol und Südtirol) und die Ebene (Aviano) – und ist durch eine vorwiegend hellhäutige Bevölkerung mit hoher Melanominzidenz gekennzeichnet. In dieser Bevölkerung werden wir die Heterogenität des Melanoms der Haut klinisch und molekular analysieren und mit Umweltdaten verknüpfen, um zu ermitteln, ob und welche Umwelteinflüsse das Entstehen der Krankheit fördern.
Projektpartner
- Lead Partner (FVG) Università degli Studi di Trieste
- Projektpartner 1 (TIR) Universität Innsbruck
- Projektpartner 2 (BZ) Azienda Sanitaria dell´Alto Adige - Comprensorio sanitario di Bolzano
- Projektpartner 3 (FVG) Centro di riferimento oncologico
Projektbudget
788.802,43 Euro
Projektdauer
15.02.2016-15.08.2019
Projektwebsite
 Coat4Cata
Coat4Cata

Coat4Cata
Entwicklung von Beschichtungen und Beschichtungsprozessen für die katalytische Abgasnachbehandlung
Ziel des Projektes ist die gemeinsame Entwicklung von katalytisch hochaktiven Beschichtungsmaterialien und Beschichtungsprozessen zur Herstellung von Abgas-Katalysatoren für Fahrzeuge und Industrie. Die mit katalytisch aktiven Pulvern beschichteten Trägermaterialien (=Katalysatoren) werden in den Abgasstrang von Verbrennungsmotoren (z.B. im PKW, LKW, Baumaschinen, Traktore, Schiffsmotoren) bzw. in das Abgassystem von Industrieanlagen (z.B. Zementwerke, Müllverbrennung) integriert. Die Katalysatoren wandeln die emittierten Schadstoffe(Stickoxide, Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe, Rußpartikel, organische Schadstoffe) in ungefährliche Komponenten, wie Wasser, Stickstoff und Kohlendioxid um. Um die zukünftig immer niedriger werdenden Grenzwerte von Schadstoffen in Abgasen einhalten zu können, ist der Einsatz von Abgas-Katalysatoren mit immer höherem Wirkungsgrad und der Einsatz von wirksameren Beschichtungsmaterialien unumgänglich. Überdies tragen wirkungsvollere Katalysatoren signifikant zur Verminderung des Ausstoßes von CO2 bei.
Projektpartner
- Lead Partner (KAR) Treibacher Industrie AG
- Projektpartner 1 (FVG) Università degli studi di Udine
Projektbudget
788.802,43 Euro
Projektdauer
01.10.2016 - 31.03.2019
Projektwebsite
 InCIMa
InCIMa

InCIMa
Intelligente Charakterisierung von intelligenten Materialien
Das Hauptziel von InCIMa ist die Schaffung einer grenzüberschreitenden delokalisierten Infrastruktur für die Synthese und Charakterisierung auf Nano-, Mikro- und Makro- Ebene von intelligenten Funktionsmaterialien durch den Einsatz modernster spektroskopischer Techniken, und von Imaging und Mapping, die die Vorteile einer breiten Palette von Strahlung vom fernen Infrarot zu harter Röntgenstrahlung ausnutzt, erzeugt sowohl konventionell als auch durch Synchrotronstrahlung. Die Kooperation wird durch die synergistische Ergänzung und Stärkung der verschiedenen analytischen und Synthese-Techniken erfolgen, bisher einzeln von den Partnern verwendet, für die Optimierung von zwei Arten von Materialien: Hartschaumstoffe aus vollständig natürlichen Polymeren aus sekundären Holzbearbeitungsprodukten, wie Tannine und Lignin, als potentielle neue Materialien für green building technology (thermische und akustische Isolierung eines Hauses), sowie zur Reinigung von Wasser von Schadstoffen die zur Familie der sogenannten "emerging pollutants" gehören (natürliche Filtersysteme). Plasmonische Metamaterialien zur Verwendung in einem spektralen Bereich von Infrarot bis Ultraviolett, für Anwendungen im Bereich der Sensoren chemischer Substanzen in niedrigen Konzentration, für Umwelt- und biomedizinische Diagnostik. Das Ideal in einem einzigen Material, wie Bio-Schäume, Absorptionskapazität von Schadstoffen und deren Nachweis zu integrieren, wird weiterverfolgt werden.
Projektpartner
- Lead Partner (FVG) Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
- Projektpartner 1 (SBG) Salzburg University of Applied Sciences
- Projektpartner 2 (SBG) Paris-Lodron-Universität Salzburg
Projektbudget
837.289,21 Euro
Projektdauer
01.01.2017 - 31.07.2019
Projektwebsite
 OutFeet
OutFeet

OutFeet
Die Ergonomie von Schuhen: von der qualitativen Analyse zur wissenschaftlichen Methode
Wohlbefinden, Komfort und Sicherheit waren im Bereich der Outdoor-Schuhe immer subjektive Parameter, die je nach individuellen Eigenschaften (Geschlecht, Gewicht, Fitness, usw.) Änderungen unterlagen. Ziel des Projekts ist es, diesen subjektiven Ansatz zu überwinden und eine rein qualitative Analyse durch eine wissenschaftliche Methode zu ersetzen. Mit diesem neuen Ansatz könnten sich Unternehmer der Branche und Verbraucher (Wanderer, Sportler, usw.) auf sichere und zuverlässige Kriterien verlassen. Unternehmen würden von erweitertem Fachwissen bei der Entwicklung und Produktion der Outdoor-Schuhe profitieren und der Endverbraucher von einer besseren Kenntnis der tatsächlichen Produkteigenschaften. Besondere Bedeutung kommt diesem Vorhaben im Projektgebiet zu, in dem die Outdoor-Schuhe in zahlreichen Tätigkeiten zum Einsatz kommen, die sich nicht auf rein sportliche Aktivitäten beschränken (wie zum Beispiel die Bergrettung) und in denen zahlreiche Unternehmen der Branche vertreten sind. Ein komfortabler Schuh ist auch ein sicherer Schuh: Dadurch werden die Folgen eventueller Unfälle begrenzt und damit die Sozialkosten. Die Partner befassen sich in ihren jeweiligen Fachgebieten mit dem Erfassen der reellen Daten, mit der Prototypenfertigung eventueller Sensoren und mit dem Vergleich der reellen Daten mit den wissenschaftlichen Daten, um daraus eine Standardmethode zu entwickeln.
Projektpartner
- Lead Partner (VEN) DOLOMITICERT SCARL
- Projektpartner 1 (IT) Università degli Studi di Padova
- Projektpartner 2 (TIR) Centro di technologia per sci e sport alpini srl
Projektbudget
451.412,74 Euro
Projektdauer
01.07.2016 - 31.12.2018
.
 AlpSporTec
AlpSporTec

AlpSporTec
Netzwerk zur Erforschung und Technologietransfer für den verbesserten Einsatz von wirtschaftlich untergeordnetem Getreide und Pseudocerealien
Der Bergsport ist für den Tourismus im alpinen Raum von entscheidender Bedeutung und stellt eine bedeutende ökonomische Größe dar. Die mit seiner Ausübung einhergehenden Sicherheitsrisiken können durch spezifische Ausrüstung maßgeblich beeinflusst werden. Vor dem Hintergrund, die Gefahr von Verletzungen minimieren und gleichzeitig den Komfort von Bergsportlern erhöhen zu wollen, setzt sich das vorliegende Projekt 3 Ziele: 1) Die Entwicklung einer textilen Faser zur Verwendung in Kletterseilen, die ihre Farbe in Abhängigkeit der UV-Strahlungsexposition und der damit einhergehenden Materialalterung ändert und dem Kletterer dadurch anzeigt, wann das Seil aus Sicherheitsgründen zu ersetzen ist. 2) Die Erforschung der Reibung von Textilien auf Schnee und Eis, mit dem Ziel, Gewebe zu entwickeln, die im Falle von Stürzen (bspw. im alpinen Skilauf) zur effizienten Geschwindigkeitsreduktion beitragen und dadurch das Verletzungsrisiko verringern. 3) Den Tragekomfort von Bergsportbekleidung durch die Entwicklung und Erforschung innovativer textiler Materialien, die günstige thermoregulatorischen Eigenschaften aufweisen und gleichzeitig Schutz vor Umwelteinflüssen sowie die zur Ausübung der Sportarten nötige Bewegungsfreiheit gewährleisten, zu erhöhen. Zur Realisierung dieser Ziele tritt ein länderübergreifendes Konsortium mit einzigartiger Expertise in Biomechanik, Leistungsphysiologie, Textilwissenschaft und Industrial Engineering zusammen.
Projektpartner
- Lead Partner (TIR) Centro di technologia per sci e sport alpini srl
- Projektpartner 1 (VEN) DOLOMITICERT SCARL
- Projektpartner 2 (TIR) Universität Innsbruck
- Projektpartner 3 (IT) Università degli Studi di Padova
Projektbudget
1.018.223,85 Euro
Projektdauer
01.07.2016 - 31.12.2018
Projektwebsite
 ICAWER
ICAWER

ICAWER
Interregional Concept for Advanced Wastewater Energy Reclamation
Kläranlagen gehören mit zu den größten kommunalen Energieverbrauchern. Gleichzeitig sind Kläranlagen in der Lage, Energie auch zur Verfügung zu stellen, da sie eigenständig Biogas produzieren. Die fortschreitende Energiewende stellt vor allem den fossilen Kraftstoffbereich vor noch ungelöste Probleme. Die Mengen an Erdöl und Erdgas können nach heutigem Stand der Technik zwar zu großen Mengen, aber nicht vollständig durch Alternativen wie Elektrizität und Wärme ersetzt werden. Der nicht substituierbare Restbedarf an Kohlenwasserstoffen übersteigt jedoch die Kapazitäten von derzeitiger Technologie bei Weitem (Quelle: Fraunhofer IWES). Kläranlagen als vorhandene und weltweit allgegenwärtige sowie sich ähnelnde Anlagentypen könnten in diesem Bereich zukünftig einen wertvollen Beitrag leisten. Die Abwasserverbände haben diese Verantwortung noch nicht erkannt, da sie ihre Hauptverantwortung, zurecht, in der Qualität der Abwasserreinigung sehen. Durch Steigerung der Energieeffizienz, sprich Senkung des Eigenbedarfs und Erhöhung der Gasproduktion könnten aber Kläranlagen zunehmend auch dieser Aufgabe gerecht werden. Die Interreg-Region ähnelt sich hier durch vergleichbare Infrastruktur, gesetzliche und ökologische Richtlinien und Abwassercharakteristik sehr. Somit ist die Übertragung von Technologie und Methoden theoretisch leicht umsetzbar und sinnvoll, da in vergangen Projekten (EnerWater) auch geografische Unterschiede und insgesamt große Potentiale erkannt wurden.
Projektpartner
- Lead Partner (TIR) SYNECO tec GmbH
- Projektpartner 1 (TIR) Universität Innsbruck
- Projektpartner 2 (BZ) SYNECO srl
- Projektpartner 3 (TIR) BioTreaT GmbH
- Projektpartner 4 (BZ) ARA PUSTERIA SPA
- Projektpartner 5 (BZ) eco center S.p.A
- Projektpartner 6 (TIR) Abwasserverband Zirl und Umgebung
- Projektpartner 7 (TIR) ARAconsult GmbH
Projektbudget
1.353.445,00 Euro
Projektdauer
11.11.2016 - 28.02.2019
Projektwebsite
Publikationen und Pressespiegel
 LowTech
LowTech

Low Tech
Alpines Bauen - Low Tech
Anhand von Analysen, Good Practice Beispielen und mit Einbeziehung lokaler Kompetenzen sollen technikreduzierte Lösungen gefunden werden, die sich aber dennoch positiv auf die Energieeffizienz des gesamten Lebenszykluses des Gebäudes auswirken, diesen ökologisch und ökonomisch verbessern bei ohne den gewohnten Komfort und Gebäudestandard einzuschränken. Die Projektergebnisse werden an baurelevante lokale KMU, Stakeholder und die Bevölkerung weitergegeben, um kosteneffizientes, hochwertiges und umweltverträgliches Bauen im Alpenraum zu fördern.
Projektpartner
- Lead Partner (BZ) Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus
- Projektpartner 1 (BZ) EURAC Research – Institut für Erneuerbare Energien
- Projektpartner 2 (BZ) NOI Techpark Südtirol - Alto Adige
- Projektpartner 3 (SBG) Fachhochschule Salzburg
- Projektpartner 4 (SBG) Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH
- Projektpartner 5 (SBG) Kompetenzzentrum Bauforschung GmbH
Projektbudget
1.685.017,00 Euro
Projektdauer
31.10.2016 - 31.12.2019
Projektwebsite
Publikationen und Pressespiegel
 AGEDESIGN
AGEDESIGN

AGEDESIGN
Stärkung der Forschungs- und Innovationskapazitäten in Ausrüstungen und Dienstleistungen für aktives und gesundes Altern
Das Projekt besteht aus einer gemeinsamen Forschungsarbeit (Veneto-Salzburg) mit dem Ziel, neue "Design Konzepte" von Produkten und Dienstleistungen für alternde Menschen zu definieren, zu entwickeln und zu testen. Hauptzweck ist es, in naher Zukunft Instrumente bereitzustellen, die die Gesundheit und das Wohlergehen älterer Menschen verbessern und bewahren und sie vor vorzeitigen körperlichen und psychischen Problemen schützen. Diese neuen künftigen Instrumente integrieren die bestehenden Technologien intelligent zu erschwinglichen Preisen, sind tief miteinander verbunden und sehr tragbar, erleichtern die häusliche Pflege und die Überwachung der körperlichen Aktivitäten innerhalb und außerhalb des häuslichen Bereichs und sind mit der Kleidung integriert, sodass sie fast zu dekorativen Gegenständen werden. Das Projekt sieht die gemeinsame Zieldefinition von 4 Forschungslinien vor, die Analyse von Unterschieden und Kompatibilität, die die Forschungsergebnisse aufweisen müssen, um in Italien und Österreich umsetzbar zu sein, die Umsetzung der Forschungsarbeit und die Erstellung von 4 „Design Konzepten“, eine demonstrative Überprüfung an einer Gruppe von Endnutzern, die Charakterisierung der Reproduzierbarkeit und die Auswertung von Formen und Methoden für die Forschungsfortsetzung. Das Projekt ermöglicht den Start einer neuen Phase der grenzüberschreitenden Forschung in einem Bereich mit hoher lokaler Nachfrage und hohem Potenzial für die künftige Entwicklung.
Projektpartner
- Lead Partner (VEN) Fondazione Centro Produttività Veneto
- Projektpartner 1 (IT) Università Iuav di Venezia
- Projektpartner 2 (VEN) Azienda ULSS 1 Dolomiti
- Projektpartner 3 (SBG) Salzburg Research Forschungsgesellschaft
- Projektpartner 4 (SBG) Paris-Lodron-Universität Salzburg
Projektbudget
1.422.219,65 Euro
Projektdauer
01.11.2016 - 30.04.2019
Projektwebsite
.
 EXOTHERA
EXOTHERA

EXOTHERA
Exosomes for regenerative, immunosuppressive, neuroprotective, and oncosuppressive therapies
Exosomes (EV) sind kleine, Membran umgebene Vesikel die den Transport von Molekülen zwischen Zellen bewerkstelligen. EVs sind durch eine molekulare Signatur gekennzeichnet und beeinflussen die Funktionder Empfängerzellen. Die geringe Größe (<1 μm) sowie die biophysikalischen Eigenschaften charakterisieren EVs als ideale Kandidaten für neue therapeutische Stoffe für eine Vielzahl von Anwendungen (Immuntherapie, zellfreie regenerative Medizin, etc.). Obwohl das Potenzial von EVs für die biomedizinische Anwendung seit Jahren erkannt ist, fehlen anwendbare Standards für die Reiningung und Qualifizierung von EVs ebenso wie Tests mit deren Hilfe eine genaue Vorhersage der therapeutischen Aktivität getroffen werden kann, und rationale Kriterien um synthetische EVs mit präzisen Funktionen zu erzeugen. Eine Zusammenarbeit von klinischen und forschungsorientierten Zentren mit hoher Expertise auf transnationaler Ebene ist daher nötig. Mit EXOTHERA wird ein integrativer Ansatz zur Korrelation von Daten geschaffen um physikalische und molekulare Eigenschaften von EVs mit Funktion und therapeutischem Nutzen in Einklang zu bringen. Dadurch wird es möglich, die besten Protokolle für die Reinigung und Quantifizierung zu bestimmen, EVs physikochemisch zu charakterisieren, die Wechselwirkung mit den Empfängerzellen zu untersuchen, und eine Korrelation aller Eigenschaften herzustellen, mit dem Ziel eine optimierte EV-basierte therapeutische Strategie in den drei Fokus zu entwickeln.
Projektpartner
- Lead Partner (FVG) Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
- Projektpartner 1 (SBG) Paracelsus Medizinische Privatuniversität
- Projektpartner 2 (FVG) Università degli studi di Udine
Projektbudget
823.263,87 Euro
Projektdauer
01.01.2017 - 31.07.2019
Projektwebsite
 EES AA
EES AA

EES AA
Entrepreneurial Ecosystem Alpe Adria
In den letzten Jahren hat sich der »Kampf um Talente« auf globaler Ebene verstärkt. Die Abwanderung von unternehmerischen Talenten und innovativen Unternehmen aus den Grenzgebieten in attraktivere Start-up Ecosysteme hat zugenommen. Kritische Aspekte sind das niedrige Niveau der internen/externen Netzwerke der Region und die Notwendigkeit, speziell Innovationsnetzwerke zu verstärken. Daher wird EES AA bei der Verknüpfung von lokalen Entrepreneurial-Hubs und Start-up-Hubs zu einem grenzüberschreitenden Entrepreneurship Cluster, in dem Technologieparks, Universitäten, Inkubatoren und Coworking-Spaces zentrale Rollen spielen, als Vorreiter aktiv. Das EES AA wird als Destination für die besten innovativen Unternehmen der Region und von außerhalb (global) sichtbar gemacht. EES AA wird erfolgreich, indem: 1) eine grenzüberschreitende EES AA Destination, durch die Entwicklung einer gemeinsamen Vision, Strategie und eines Aktionsplans (Veranstaltung gemeinsamer Lighthouse Events, strategische Abstimmung und Koordination mit anderen Entrepreneurial Ecosystemen) gebildet wird. 2) ein systematisiertes Paket von Services auf höchstem Niveau für den Aufbau und das Wachstum innovativer KMUs / Start-ups im Programmgebiet (Mobilisierung, Start-up Softlanding, Vermarktungspotential) entsteht. 3) ein grenzüberschreitendes niveauvolles Begleitprogramm zur Betreuung bereitgestellt wird. 4) ein Bildungsprogramm für Unternehmertum und dessen Pilotierung im Projektgebiet entwickelt wird.
Projektpartner
- Lead Partner (KAR) Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds
- Projektpartner 1 (FVG) Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico
- Projektpartner 2 (VEN) t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.
- Projektpartner 3 (KAR) Lakeside Science & Technology Park GmbH
- Projektpartner 4 (KAR) build! Gründerzentrum Kärnten GmbH
Projektbudget
1.647.367,81 Euro
Projektdauer
01.01.2017 - 01.07.2019
Projektwebsite
Publikationen und Pressespiegel
 FACEcamp
FACEcamp

FACEcamp
Kompetenzzentrum zur Unterstützung der Entwicklung moderner Fassadensysteme
Dieser Antrag zielt auf Stärkung und nachhaltige Stabilisierung transnationaler Kooperationen zwischen Firmen und Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet moderner Fassadensysteme mit Fokus auf Energieeffizienz, Komfort und Gesundheit ab. Dabei sollen Stakeholder und Firmen bei der Bewältigung planerischer Anforderungen durch moderne Fassadensysteme unterstützt werden. Kernziele sind (1) der Aufbau eines grenzüberschreitenden Kompetenzzentrums für moderne Fassadensysteme, um der Kompetenz aufzubauen und Know-how zwischen Forschungseinrichtungen und Firmen auszutauschen (2) sowie die Verbesserung bestehender Simulations-, Mess- und Testmethoden, um den Mehrwert fortschrittlicher Fassadensysteme quantifizieren zu können. Die Einrichtung des Kompetenzzentrums wird dank transnationaler Interessensvertretungen nach der Bottom-Up-Methode erfolgen. Workshops, Schulungen und Konferenzen werden zur überregionalen Verbreitung der Fachkompetenz organisiert. Mit diesem Projekt soll (1) ein grenzüberschreitendes Kompetenzzentrum aufgebaut werden, (2) die Brücke zwischen Praktikern, Planern und Forschern geschlagen werden, und (3) die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe für qualitativ hochwertige und effiziente Fassadenprodukte gestärkt werden. Die Fachexpertise wird dadurch sowohl regional als auch auf europäischer und internationaler Ebene sichtbar. Das Kompetenznetzwerk bereitet damit einen attraktiven überregionalen Markt für den innovativen Fassadenbau.
Projektpartner
- Lead Partner (BZ) Accademia Europea Bolzano
- Projektpartner 1 (BZ) IDM Suedtirol - Alto Adige
- Projektpartner 2 (TIR) Universität Innsbruck
- Projektpartner 3 (TIR) HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH
- Projektpartner 4 (TIR) Bartenbach GmbH
- Projektpartner 5 (BZ) Glassadvisor Srl
- Projektpartner 6 (BZ) FRENER & REIFER SrL
Projektbudget
1.178.888,44 Euro
Projektdauer
09.01.2016 - 31.12.2019
Projektwebsite
 StarEU
StarEU

StarEU
Startup.Euregio
Startups und Gründungen aus bestehenden Unternehmen ("Spin-outs") sind der Motor für zukünftige Entwicklungen. Sie sind die Zielgruppe von StarEU. Beide werden in diesem Projekt der Einfachheit halber als "Startup" bezeichnet. In Tirol, Südtirol und Trentino gibt es schon seit Jahren Bemühungen auf regionaler Ebene, ein Startup Ökosystem zu schaffen. Jedoch nur gemeinsame Anstrengungen führen zum Ziel, ein dynamisches Ökosystem für Startups aufzubauen und international zu bestehen. Darum haben sich Tirol und Südtirol dazu entschlossen, das Projekt gemeinsam mit Trentino, welches außerhalb des Programmgebiets liegt, durchzuführen: Die Stärken des Trentino ergänzen die beiden Regionen ideal, um ein nachhaltiges, dynamisches Ökosystem aufzubauen. Es bietet sich die einmalige Gelegenheit, die Europaregion Tirol als "Gründerland" auf europäischer Ebene zu entwickeln. Hierbei soll vor allem auf das bereits Bestehende aufgebaut und sollen neue Inhalte aus den weltweit führenden Gründer-Hotspots integriert werden. Die Wichtigkeit des Projekts wurde durch die Landeshauptleute der drei Regionen (Beschluss im EVTZ-Vorstand v. 28.5.15) hervorgehoben. Ziel ist ein nachhaltiges Startup-Ökosystem erfolgreich aufzubauen, ein interregionales Startup Netzwerk mit min. 100 aktiven Mitgliedern zu schaffen. Dabei sollen min. 100 Projekte unterstützt werden, die zu mehr als 80 Gründungen und über 100 Kooperationen führen werden. Zudem sollen mehr als 60 Investoren in ein Netzwerk integriert werden
- Lead Partner (TIR) Standortagentur Tirol GmbH
- Projektpartner 1 (BZ) NOI AG
- Projektpartner 2 (IT) Trentino Sviluppo Spa socio unico
Projektbudget
1.003.212,55 Euro
Projektdauer
01.02.2017 - 31.12.2019
Projektwebsite
Publikationen und Pressespiegel
.
 ALFFA
ALFFA

ALFFA
Gesamtheitliche (skalenübergreifende) Analyse der Einflussfaktoren und Ihre Wirkung auf die Fischfauna im inneralpinen Raum
Mit zunehmender Nutzung unserer Kulturlandschaft unterliegen auch die Gewässersysteme einem ansteigenden Einfluss durch diverse anthropogene Maßnahmen. Die meisten Gewässer sind durch Eingriffskombinationen mehrfach belastet, ein sich daraus ergebender Multiplikationseffekt kann zu dramatischen Veränderungen der aquatischen Lebensräume und ihrer Organismengemeinschaften führen. Als Qualitätsindikatoren für Gewässersysteme werden europaweit Fische als Bioindikatoren verwendet. Über das vorhandene Artenspektrum, die Abundanz- und Dominanzverhältnisse und den Populationsaufbau der einzelnen Arten können verlässliche Aussagen über den Zustand eines Gewässers getätigt werden. Die teilweise dramatischen Veränderungen der Fischfauna in Tirol und Südtirol reichen vom lokalen Rückgang einzelner Populationen bis zur aktuellen Bedrohung der Bestände und im Einzelfall sogar bis zum Verschwinden von Arten. Eine weitere Bedrohung liegt in der genetischen Verunreinigung der ursprünglichen Arten durch Fehlbesatz. Durch diese Fehlbewirtschaftung kann es zum Verschwinden autochthoner Arten kommen. Im Gegensatz zu den meisten bisherigen Untersuchungen sollen nicht einzelne Verursacher, sondern die Kombination möglichst aller Einflüsse großräumig erfasst und mit Hilfe geostatistischer und skalenübergreifender Modelle erkennbar gemacht werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen bei zukünftigen Entscheidungen bezüglich Gewässer- und Umweltmanagement eine wichtige Hilfe darstellen.
Projektpartner
- Lead Partner (BZ) Accademia Europea Bolzano
- Projektpartner 1 (TIR) Universität Innsbruck
Projektbudget
1.026.894,08 Euro
Projektdauer
02.10.2017 - 30.06.2019
Projektwebsite
 FuturCRAFT
FuturCRAFT

FuturCRAFT
Die Berufe der Zukunft: Neue Chancen durch Digitalisierung
Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und macht auch vor der Arbeitswelt im Handwerk nicht halt. Die Entwicklung in den nächsten Jahren wird viele Berufe maßgeblich verändern. Doch wie sehen die Handwerksberufe der Zukunft aus, welche Technologien werden wo Einsatz finden und welche Kompetenzen werden in welchen Berufen benötigt? Wie ändern sich die Berufe im Handwerk hinsichtlich der fortschreitenden Digitalisierung? Unternehmen brauchen neue Wege, um einerseits ihre Mitarbeitenden für die digitale Arbeitswelt zu qualifizieren und andererseits das Potenzial neuer Technologien richtig einzusetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Ziel des Projekts FuturCRAFT ist, mögliche Zukunftsszenarien der Berufe im Handwerk zu definieren und für Handwerksbetriebe greifbar darzustellen. Ein Grundverständnis für die zukünftige Entwicklung der Handwerksberufe soll geschaffen werden, aus der echte Partizipation wächst. Das Projekt soll somit die Basis dafür schaffen, dass Handwerksbetriebe in den Projektregionen sich künftig aktiv in die Gestaltung von digitalisierten Geschäftsmodellen und Prozessen in ihrem Unternehmen einbringen und sich für die digitale Arbeitswelt qualifizieren können. Gleichzeitig soll das Projekt einen Beitrag zur Aktualisierung bestehender Ausbildungsangebote und Kompetenzprofile leisten und eine Basis für den Ausgleich des bestehenden "Skills Mismatch" am Arbeitsmarkt schaffen.
Projektpartner
- Lead Partner (BZ) APA-formazione e servizi cooperativa
- Projektpartner 1 (VEN) Confartigianato Vicenza
- Projektpartner 2 (SBG) Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH
- Projektpartner 3 (BZ) Eurac Research
- Projektpartner 4 (VEN) t2i - Technologie Transfer und Innovation s.c. a r.l.
Projektbudget
631.980,00 Euro
Projektdauer
01.11.2017 - 31.03.2022
 CROSSINNO
CROSSINNO

CROSSINNO
Verstärkung der Innovationsprozesse der traditionellen KMUs mit Cross-fertilizationmassnahmen für die kulturellen und kreativen Industrien
Die im Alpenbereich angesiedelten Unternehmen sind oft klein und abgeneigt wichtige Veränderungsprozesse einzuführen, die aber von den veränderten Bedürfnissen der Kunden und von der Notwendigkeit in überzeugender Weise in die internationalen Märkte einzutreten verlangt werden. Der Wechsel, der von manchen Unternehmen erforderlich ist, betrifft nicht nur die Unterstützung der Einführung von neuen Technologien, sondern auch die Anerkennung des Wertes der eigenen Produktion und eine bessere Aufmerksamkeit gegenüber den Kunden. Diese Lösungen können mit der Einleitung einer wirksamen Kooperation mit den kulturellen und kreativen Betrieben (digitale, multimediale, grafische, Fachleute der Kreativität, usw) und intern durch die Aufwertung des eigenen Produktionsmodell und der kulturellen (Museen, Theater, Musikanten, Monumenten, Festen und Traditionen, usw) und natürlichen (die Dolomiten, Naturparke, das Wasser, usw) Businessreichtümer, die das Gebiet kennzeichnen, gegeben werden.Das Projekt CROSSINNO soll die Qualität der Dienstangebote für die Unternehmen steigern um diese Art von Innovationsprozessen zu unterstützen: einen positiven Kreislauf zwischen traditionellen Unternehmen der Branchen Holz-Ausstattung,Agrofood, Tourismus,usw,kreative und kulturelle Unternehmen und kulturelle und natürliche Anlagen, die tatsächliche Entwicklungs- und Unternehmungs-"Motoren" werden können. CROSSINNO wird ein Kooperationsmodell für die Verstärkung dieses positiven Kreislaufs ausarbeiten.
Projektpartner
- Lead Partner (VEN) Camera di Commercio Industria artigianato agricoltura di Treviso Belluno
- Projektpartner 1 (SBG) Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH
- Projektpartner 1 (VEN) Amministrazione provinciale di Belluno
- Projektpartner 1 (FVG) Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale cultura e sport
Projektbudget
659.235,00 Euro
Projektdauer
01.10.2019 - 31.03.2022
Projektwebsite
 P-CARE
P-CARE

P-CARE
Eine technologische Plattform zur Bekämpfung von Krebstherapieresistenzen
Die Entstehung von Therapie-Resistenzen ist einer der häufigsten Gründe für das Versagen von Krebstherapien und bedeutet das Wiedererscheinen der neoplastischen Krankheit. Dies hat verheerende Konsequenzen für den Behandlungserfolg des Patienten und bedeutet erhöhte Kosten für Gesundheitssysteme. Das Verstehen der Mechanismen der Resistenzentstehung und Entwickeln von Strategien zur Therapie-Resensibilisierung sind zentrale Herausforderungen für die moderne Krebsforschung. Das Projekt P-CARE hat das Ziel die Kollaboration zwischen italienischen und österreichischen Instituten im Bereich der genetischen, klinischen und biotechnologischen Forschung zu stärken, um die Ursachen von Resistenzen zu verstehen und die Behandlungseffizienz von Krebstherapien zu verbessern. Es wird eine gemeinsame Plattform zur Identifizierung von Arzneimitteln, welche resistente Tumore wieder für Therapien sensibilisieren können, erstellt. Dies wird durch das Repositionieren von Arzneimitteln, die bereits zur Behandlung von anderen Krankheiten in Gebrauch sind, erreicht werden. Mittels in vitro Nachbildung der Immunantwort des Tumor-Mikroumwelt werden Ansätze von personalisierter Präzisionsmedizin verfolgt um Immunotherapie-Resistenzen überwinden zu können. Mit P-CARE entsteht ein grenzüberschreitendes Netzwerk zur gemeinsamen Nutzung von Technologien und Kompetenzen die für den Sektor der akademischen und klinischen Krebsforschung in, aber auch außerhalb des Programmgebiet zugänglich sein werden.
Projektpartner
- Lead Partner (FVG) Università degli Studi di Trieste
- Projektpartner 1 (BZ) Südtiroler Sanitätsbetrieb - Gesundheitsbezirk Bozen
- Projektpartner 2 (TIR) ADSI - Austrian Drug Screeening Institute GmbH
- Projektpartner 3 (TIR) Medizinische Universität Innsbruck
Projektbudget
838.556,08 Euro
Projektdauer
01.08.2019 - 31.01.2022
.
 EPIC
EPIC

EPIC
EPigenetics of Immunity in Cancer Dauer Beginn
Krebserkrankungen weisen in dem Gebiet von Interreg V-A Italia-Österreich eine hohe Häufigkeit auf. Als Folge dessen, und auf Grund kostspieliger neuer Therapieformen, sind die Gesundheitsbudgets unter zunehmenden Druck. Die Unterstützung einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung unter Vermeidung von Ineffizienz und Verschwendung im Gesundheitssystem ist daher ein dringend zu behandelndes Thema. Das EPIC Projekt wird sich mit diesem Thema auseinandersetzen und bessere Lösungen für nachhaltigere Krebsbehandlungen entwickeln. Diese basieren nicht nur auf der Entwicklung neuer Medikamente, sondern werden sich auch auf die Verbesserung von Vorhersagemethoden zur Wirksamkeit von Medikamenten in der Krebsimmuntherapie konzentrieren. Italienische und österreichische Forschungseinrichtungen mit Exzellenzanspruch und komplementärer Expertise (Chemie, Medizin, Biologie und Bioinformatik) werden das EPIC Netzwerk erschaffen, um neue Fortschritte in der Immuntherapie bei Krebs zu ermöglichen und Akademien, klinischen Zentren und allen weiteren Interessengruppen offen zugängliches Wissen zur Verfügung zu stellen. Das Programm entspricht den RIS3 (Regional Innovative Specializations) Zielen „smart-health“ für die Regionen Friaul- Julisch Venezien und Südtirol, sowie der Life Science Strategie (WISS 2025) für Salzburg.
Projektpartner
- Lead Partner (FVG) Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Area Medica - DAME
- Projektpartner 1 (FVG) Università degli Studi di Trieste
- Projektpartner 2 (SBG) Paris-Lodron-Universität Salzburg
- Projektpartner 3 (BZ) Eurac Research
Projektbudget
940.370,64 Euro
Projektdauer
25.09.2019 - 25.03.2022
 CLEANSTONE
CLEANSTONE

CLEANSTONE
Rückgewinnung und Aufwertung von Steinaufbereitungsabfällen für ökologische Nachhaltigkeit
Der Abbau von Gesteinskörnungen und Natursteinen hat verschiedene Auswirkungen auf die Umwelt und das umgebende Ökosystem. Das Ziel von CLEANSTONE ist es, den Umweltschutz und die Ressourceneffizienz in der natursteinproduzierenden Industrie zu verbessern, indem eine innovative Technologie entwickelt wird, die Abfälle aus der Steinbearbeitung minimiert und wiederverwendet sowie die Einführung optimierter Fertigungsverfahren fördert. Dies geschieht durch Maßnahmen auf mehreren Ebenen (technologisch, verhaltensmäßig, normativ), um den Steinerzeugungssektor wettbewerbsfähiger und umweltverträglicher zu machen. Die wichtigsten Projektergebnisse sind: 1) Entwicklung von Richtlinien zur Festlegung der Kriterien für die Bewertung der Umweltauswirkungen sowie die Qualitätssicherung innovativer Prozessabläufe, die eine optimierte Rückgewinnung verwertbarer Sekundärrohstoffe aus Aufschlämmungen und gebrochenen Platten verschiedener Steinsorten ermöglichen; 2) Ein Grundlagendokument mit Vorschlägen zur Änderung der Abfallgesetzgebung für Steinerzeugnisse in Österreich und Italien. Das Projekt ist Vorreiter, da diverse Wiederverwendungsstechniken für Abfall und Staubprodukte in einem Kontext gebracht werden, der speziell für Unternehmen im Steinsektor (meistens KMUs) konzipiert wurde. Hierdurch werden alle von einem stärkeren Bewusstsein profitieren, das durch die Umsetzung der vorgeschlagenen Arbeiten in Bezug auf die Dynamik der Kreislaufwirtschaft und den Umweltschutz entsteht.
Projektpartner
- Lead Partner (FVG) Università degli Studi di Udine - Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - DPIA
- Projektpartner 1 (IT) Università degli Studi di Padova
- Projektpartner 2 (KAR) Fachhochschule Kärnten - gemeinnützige Privatstiftung
- Projektpartner 3 (VEN) Confartigianato Vicenza
- Projektpartner 4 (KAR) E.C.O. Institut für Ökologie
Projektbudget
862.419,5 Euro
Projektdauer
01.11.2019 - 31.10.2021
 MC 4.0
MC 4.0

MC 4.0
Mass customization 4.0 – sviluppo e diffusione di competenze e strumenti di mass customization e tailoring per le PMI dello smart living
Das PROJEKT MC 4.0 verbessert die KMU-Innovationsbasis beim SMART LIVING, um die neuen Herausforderungen der Wettbewerbsfähigkeit und der INDUSTRIE 4.0 im Programmgebiet zu meistern. Ihre Fähigkeiten, die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zu erschwinglichem Preis (MC – Mass Customization) zu erfüllen, werden über digitalisierte Personalisierung (4.0) gestärkt, damit sich der Kunde an die Produktionskette der KMU nähert. Dadurch sinken Kosten, Lieferzeiten werden kürzer und Produktqualität wird gesichert. Die digitalisierte Personalisierung braucht immer leistungsfähigere Instrumente zur Produktkonfigurierung – PRODUKTKONFIGURATOREN – die Kunden und Back-Office des Unternehmens direkt und strategisch verbinden. Über 120 KMUs aus Italien und Österreich sind direkt involviert und eine Partnerschaft wird angeknüpft, die wissenschaftliche und technologische Kenntnisse (PP1, PP3, PP5) mit den KMU-Bedürfnissen (LP, PP2, PP7) und die Industrie (PP4, PP6) zusammentut. Die Partner: - entwickeln für KMU spezifische BEWERTUNGS- UND FÜHRUNGSINSTRUMENTE zur MC 4.0; - planen und starten MC 4.0 DEA CENTERS, die die MC 4.0 in den einzelnen KMU mitentwickeln; - strukturieren und beleben KMU-CLUSTERS, die an MC 4.0 interessiert sind; - lancieren eine PLATTFORM MC 4.0 mit Dienstleistungen für die MC 4.0, inklusiv die B2C-Kommunikation; - starten ein nachhaltiges GRENZÜBERSCHREITENDES MC 4.0 KOMPETENZNETZWERK für KMU.
Projektpartner
- Lead Partner (VEN) Apindustria Vicenza
- Projektpartner 1 (IT) Università degli Studi di Padova
- Projektpartner 2 (VEN) Fondazione Centro Produttività Veneto
- Projektpartner 3 (BZ) Freie Universität Bozen
- Projektpartner 4 (FVG) ROEN EST SPA
- Projektpartner 5 (KAR) Universität Klagenfurt
- Projektpartner 6 (KAR) SelectionArts Intelligent Decision Technologies GmbH
- Projektpartner 7 (KAR) Energieforum Kärnten
Projektbudget
1.012.860,60 Euro
Projektdauer
01.09.2019 - 30.11.2021
 InCIMa4
InCIMa4

InCIMa4
InCIMa for Science and SMEs
InCIMa4 baut auf das Interreg ITAT Projekt InCIMa auf, das durch Stärkung von F&I und synergische Zusammenarbeit seiner Partnerinstitute Elettra-ST, FHS und PLUS eine delokalisierte, grenzübergreifende Infrastruktur für Entwicklung und multi-Technik Charakterisierung intelligenter Materialien etabliert. Schlüsselfaktoren für InCIMa4 sind die dort erzielten vielversprechenden Ergebnisse bei Entwicklung und Charakterisierung natürlicher Tannin-Bioschäume, neuer Materialien für Grünes Bauen, und von plasmonischen Objekten für Messanwendungen sowie die Erweiterung der Partnerschaft mit drei Innovationszentren, Area Science Park (Triest), t2i (Treviso) und ITG (Salzburg). InCIMa4 will die grenzübergreifende Kooperation stärken, i) zwischen Forschungszentren indem es die technische und menschliche Expertise für Entwicklung und Analyse smarter Materialien, insbesondere neuer Polymere auf der Basis von Tannin und kostengünstiger plasmonischer Strukturen, stärkt und Protokolle für die integrierte Analyse sowie Instrumentierung zur Charakterisierung „in Operation“ und auf der Nanoskala implementiert (Ziel 1) und ii) zwischen Forschungszentren und KMUs, indem es KMUs aus dem Programmgebiet die InCIMa Plattform verfügbar macht (Ziel 2). InCIMa4 wird durch Stärkung des Technologietransfers und Ausbildung junger, für industrielle Belange sensibilisierter Forscher dazu beitragen, den Innovationsgehalt von Grundlagen- und angewandter Forschung zu erhöhen.
Projektpartner
- Lead Partner (FVG) Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
- Projektpartner 1 (SBG) Fachhochschule Salzburg GmbH
- Projektpartner 2 (FVG) Area di Ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park
- Projektpartner 3 (SBG) Paris-Lodron-Universität Salzburg
- Projektpartner 4 (SBG) Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH
- Projektpartner 5 (VEN) t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.
Projektbudget
845.935,52 Euro
Projektdauer
01.09.2019 - 02.03.2022
Projektwebsite
Publikationen und Pressespiegel
.
 GPP4Build
GPP4Build

GPP4Build
Green Public Procurement for Buildings
Das Green Public Procurement (GPP) ist eine der wichtigsten Aktivitäten der öffentlichen Verwaltung mit einer der größten Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft. Durch die ökologische Bewertung der Einkaufsverfahren hat die öffentliche Verwaltung die Aufgabe, „jene Produkte und Dienstleistungen auszuwählen, die im Vergleich zu anderen Produkten und Dienstleistungen, die für den gleichen Zweck verwendet werden, einen geringen oder reduzierten Eintrag auf die Umwelt haben". Die Umsetzung der EU- Richtlinien in Bezug auf das GPP und die jüngsten Veröffentlichungen über die Kreislaufwirtschaft begrenzen jedoch die Entwicklung einiger Referenzmärkte in Italien und Österreich, insbesondere jene der Bauwirtschaft. Der Hauptgrund dafür sind die unterschiedlichen Stufen der Umsetzung der Richtlinien in den beiden Ländern und die (technischen und wirtschaftlichen) Schwierigkeiten der KMU auf das notwendige Wissen zuzugreifen, um auf die spezifischen Vorgaben zu reagieren. Hauptziel des Projekts ist daher die Konzeption, Entwicklung und Aktivierung eines transnationalen Netzwerkes von Kompetenzen und Dienstleistungen im Bereich GPP im Bausektor (CAM GPP facilitator service). Ausgehend von einer Kompetenzplattform (competence plattform) und zwei Pilotprojekten (Kompetenzträger/zentrum) wird ein neues Netzwerk für KMUs aufgebaut, um die Ökodesign und Umweltzertifizierung neuer Produkte und Projekte mit geringen Umweltauswirkungen gemäß den EU- Richtlinien über GPP zu unterstützen.
Projektpartner
- Lead Partner (BZ) Agenzia per l'Alto Adige - CasaClima
- Projektpartner 1 (BZ) Freie Universität Bozen
- Projektpartner 2 (IT) Università degli Studi di Padovae
- Projektpartner 3 (SBG) Fachhochschule Salzburg GmbH
- Projektpartner 4 (SBG) Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH
- Projektpartner 5 (FVG) Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia
Projektbudget
749.856,93 Euro
Projektdauer
01.10.2019 - 30.09.2021
 BIGWOOD
BIGWOOD

BIGWOOD
BIGWOOD: Bewusstseinsbildung sowie Abbau von Vorurteilen und Barrieren für einen erhöhten Einsatz von Holz bei großvolumigen Bauten
Gebäude aus Holz sind heute weltweit präsent. Ein Grund hierfür ist, dass das nachhaltige Material Holz sowohl von Regierungen gefördert, als auch in der öffentlichen Meinung positiv wahrgenommen wird. Insbesondere im Bereich von mehrgeschossigen Gebäuden gilt es aber, den Einsatz von Holz maßgeblich zu erhöhen. Dies auch aktuell vor dem Hintergrund, dass aufgrund der enormen Flut- und Sturmschäden 2018 im Veneto tausende Bäume dringend aus den Wäldern entfernt und rasch verarbeitet werden müssen. Der großvolumige Einsatz von Holz bietet hier eine Chance. Um dies zu erreichen, ist es aber erforderlich, das Vertrauen von Baufirmen, lokalen Regierungen, etc. und auch der Öffentlichkeit in das Material Holz für dessen Einsatz im großvolumigen Bereich maßgeblich zu stärken. Hierfür werden Kooperationen in F&E, Ausbildung, Knowhow Transfer und best practice etabliert. Dabei sind Bewusstseinsbildung sowie der Abbau von Vorurteilen und Barrieren die besonderen Herausforderungen. Das Projekt BIGWOOD setzt hierbei auf den Aufbau eines überregionalen Netzwerkes und schafft dabei ein Umfeld für F&E sowie für Ausbildung und Training. Es gilt, Qualitätsstandards zu definieren und wichtige Aspekte rund um die Planung von Holzbauten zu kommunizieren. Ein zentrales Ziel ist dabei die Realisierung von 3 unterschiedlichen "Demonstratoren": zwei kleinere Mockups (1:5, 1:20) sowie ein 1:1 Mockup, gebaut in Bozen am Gelände des NOI Techparks, auch für den Einsatz bei involvierten Schulen
Projektpartner
- Lead Partner (BZ) Freie Universität Bozen
- Projektpartner 1 (TIR) proHolz Tirol
- Projektpartner 2 (VEN) CENTRO CONSORZI
- Projektpartner 3 (TIR) Universität Innsbruck
Projektbudget
883.831,28 Euro
Projektdauer
01.07.2019 - 31.03.2022
Projektwebsite
 SensorBIM
SensorBIM

SensorBIM
SensorBIM - Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden durch BIM und RFID Technologien
Die Einstufung des Projektes sieht voraus, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Forschungsinstituten zu stärken und gleichzeitig die Innovationsbasis für Unternehmen zu verbessern. Fokus ist auf das System „Gebäude“, durch die Entwicklung einer integrierten Hardware und Software für Gebäudefassaden und Anlagen zur Errichtung und zum Management von nachhaltigen Gebäuden. Das Projekt befasst sich mit einer der wichtigsten technologischen Herausforderungen für die Bauindustrie, und zwar das intelligente Management von Energieeffizienz und Gebäudekomfort. Die Gebäudeplanung und -betrieb sollen, durch die Anwendung von Building Information Modeling und die Nutzung von RFID-Sensoren, für den gesamten Lebenszyklus optimiert werden. Ziel des Projektes ist, einerseits, die Entwicklung einer integrierten Plattform, die die Grenzen aktueller Lösungen überschreitet (mangelhafte System-Interoperabilität, Schwierigkeiten bei der Anwendung auf bestehende Gebäude) und für KMU übernommen werden kann oder als Referenz dienen kann. Nämlich spielen die KMU im Programmgebiet eine wichtige Rolle. Anderseits zielt das Projekt darauf ab, Fassadensysteme mit intelligenten Regulierung und neue an Sensoren mit RFID-Technik angeschlossene Systeme zur Anlagensteuerung zu gestalten. Diese Systeme werden eine drastische Reduzierung des realen Energieverbrauchs von Gebäuden und eine Verbesserung der Effizienz, der Wartungsarbeiten und der Inspektion der Elemente ermöglichen.
Projektpartner
- Lead Partner (VEN) t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.
- Projektpartner 1 (BZ) Eurac Research
- Projektpartner 2 (BZ) CAEmate SRL
- Projektpartner 3 (TIR) Universität Innsbruck
- Projektpartner 4 (TIR) inndata Datentechnik GmbH
- Projektpartner 5 (BZ) Enetec AG
- Projektpartner 6 (FVG) EMK S.P.A.
- Projektpartner 7 (TIR) Steinbacher Dämmstoff GmbH
Projektbudget
1.103.682,45 Euro
Projektdauer
01.09.2019 - 28.02.2022
Projektwebsite
 IHNES
IHNES

IHNES
Interregional Hospital Network for Energy Sustainability
Krankenhäuser gehören zu den energieintensivsten Sektoren. 6000 kWh Strom und 29.000 kWh Wärme pro Jahr und Patientenbett (Viamedica (2009): "Klinergie 2020"), entsprechen dem Energieverbrauch zweier, moderner Einfamilienhäuser. Neben dem 24/7 Heiz- und Kühlbedarf wird Energie für Sterilisierung, Licht und Medizintechnik benötigt. Studien und praktische, bereits umgesetzte Projekte zeigen, dass bis zu 40% des Strombedarfs und mehr als 30% der Wärmeenergie einspart werden können. Unterschiedliche klimatische und gesetzliche Rahmenbedingungen sowie unterschiedliche Schwerpunkte führen zu unterschiedlichen Anforderungsprofilen in energietechnischer Hinsicht. Auf Basis einheitlicher Energiekennzahlen soll die Wirksamkeit von Effizienzmaßnahmen validiert und damit die Basis für eine schnellere und erfolgreiche Replikation zu schaffen. Um das Thema Energieeffizienz und Energiemanagement im Gesundheitssektor zu institutionalisieren wird ein interregionales Netzwerk aus Krankenhausbetreibern, Forschungseinrichtungen und Ingenieurbüros geschaffen. Dabei werden Erfahrungen aus der Umsetzung und Planung vergleichbarer Maßnahmen in anwendbaren Konzepten zusammengefasst. Im Projekt wird eine Toolbox für Krankenhäuser, zur Bewertung und Planung spezifischer Effizienzmaßnahmen, entwickelt.
Projektpartner
- Lead Partner (TIR) SYNECO tec GmbH
- Projektpartner 1 (TIR) Tirol Kliniken GmbH
- Projektpartner 2 (SBG) Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsges.m.b.H. - Technik, Bau und Liegenschaften - Energiemanagement
- Projektpartner 3 (BZ) Südtiroler Sanitätsbetrieb
- Projektpartner 4 (BZ) Eurac Research
- Projektpartner 5 (BZ) Kofler Energies Italia srl
- Projektpartner 6 (FVG) Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
Projektbudget
650.217,39 Euro
Projektdauer
01.06.2019 - 31.12.2021
.
 FasTher
FasTher

FasTher
Multifunktionale umweltfreundliche Lackiersysteme
Das Projekt zielt darauf ab, neue Pulverbeschichtungstechniken mit geringen Umweltauswirkungen durch die Verwendung von Nano-Additiven zu entwickeln, die den Korrosionsschutz von Metallkomponenten erhöhen und gleichzeitig die Eigenschaften der thermischen und elektrischen Leitfähigkeit verbessern. In dem Projekt werden neue Formulierungen für Farben in Pulvern auf Basis von Polyurethan und Polyester mit Zusatz funktionaler Nanopartikel unter Verwendung innovativer Mischtechniken untersucht, die auf die vollständige und homogene Verteilung der Partikel in der Polymermatrix abzielen. Die optimierten Lösungen werden dann an verschiedenen Metallkomponenten angewendet und getestet, um die Funktionalität der neuen Beschichtungen zu überprüfen und somit die potenzielle Wertschöpfung der Endprodukte zu erhöhen. Das Konsortium, das sich aufgrund seiner Fachkenntnisse in den verschiedenen Aspekten des Projekts gebildet hat, gewährleistet ein hohes Maß an Erreichung der gesetzten Ziele und ermöglicht durch seine technologische und akademische Vernetzung die anschließende Übertragung von Ergebnissen im gesamten grenzüberschreitenden Bereich.
Projektpartner
- Lead Partner (FVG) Università degli Studi di Udine - Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - DPIA
- Projektpartner 1 (KAR) PLT GmbH
- Projektpartner 2 (FVG) ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.
Projektbudget
715.055,00 Euro
Projektdauer
03.06.2019 - 02.06.2021
 SEnSHome
SEnSHome

SEnSHome
Sensoren für besondere Räume. Ihr Haus so normal wie möglich und so besonders wie nötig
Im SENSHOME-Projekt wird ein neues Smart Home-Design mit neuen Technologien erforscht, entwickelt und in Häuser „so normal als möglich“ integriert, damit Menschen mit Behinderungen autonom darin wohnen können. Dabei wird ein intelligentes Sensornetzwerk implementiert um gefährliche Ereignisse zu erkennen, um den Komfort und das Wohlbefinden in Räumen zu verbessern (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Akustik) und um eine Energieeinsparung zu ermöglichen. Um gefährliche Situationen zu identifizieren und diese von normalen Ereignissen zu unterscheiden wird eine Kombination von mehreren Sensoren (Mikrofon Arrays, Thermo-/Lichtsensoren) umgesetzt. Außerdem werden neue Einrichtungslösungen mit integrierter Technik entwickelt. Das innovative Ziel ist es, ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen und damit ein hohes Maß an Privatsphäre zu gewährleisten. SENSHOME schließt die Lücke zwischen einem unabhängigen Leben zu Hause und Pflegeheimen und unterstützt dabei alle beteiligten Nutzergruppen mit Fokus auf die Primärnutzer (Menschen mit Autismus) welche nicht alleine leben können aber auch keine durchgehende Betreuung benötigen. Für eine nachhaltige Strategie könnte die SENSHOME Lösung in Hinblick auf die persönliche Sicherheit von älteren Menschen angepasst werden. Die konkrete Idee des SENSHOME Projekts ist es mittels einer zentralen Architektur und verschiedenen Sensordaten das Befinden und die Situation von Personen zu erfassen.
Projektpartner
- Lead Partner (BZ) Freie Universität Bozen
- Projektpartner 1 (KAR) Fachhochschule Kärnten - gemeinnützige Privatstiftung
- Projektpartner 2 (FVG) Università degli Studi di Trieste
- Projektpartner 3 (VEN) Eureka System s.r.l.
Projektbudget
982.422,96 Euro
Projektdauer
01.10.2019 - 31.03.2022